Bevor Sie einen Gin kaufen, sollten Sie alles über die Herstellungsschritte von Gin erfahren
Beim Gin kaufen können Sie beobachten, dass verschiedenen Gin Sorten die Aromen in unterschiedlichen Abschnitten der Produktion zugesetzt wurden. Grundsätzlich wird zwischen einer Aromatisierung während und nach der Destillation unterschieden. Dabei können verschiedene Methoden wie Kaltauszug, Heißauszug oder Mehrfacharomatisierung angewandt werden. Es gibt verschiedene Arten, wie ein Gin hergestellt werden kann und auch zahlreiche Möglichkeiten, um dem neutralen Alkohol das gewünschte Aroma hinzuzufügen. Dennoch gibt es vier Phasen, in die die Produktionsschritte grob eingeteilt werden können, wobei diese Schritte und eventuelle Zwischenschritte je nach Destillateur variieren können. Der erste Schritt Richtung Gin kaufen beginnt mit der Mazeration. Hierbei werden dem neutralen Alkohol die Gewürze hinzugefügt. Danach folgt die Destillation. Dafür wird der gewürzte Alkohol in einen Kessel gegeben. Dann siedet der Alkohol und stößt Dämpfe aus, bevor er wieder abkühlt. Als Nächstes muss der Gin lagern, dies dauert, je nach Hersteller und Sorte, zwischen einer und vier Wochen. Nach der Lagerung wird der Gin mit Wasser auf Trinkstärke verdünnt und vom Hersteller an die verschiedenen Läden geliefert, damit der Kunde seinen Gin kaufen kann. Dies geht entweder über einen Gin Shop vor Ort oder online. Neben Gin können Sie bei uns übrigens auch Rum kaufen. Unser Sortiment ist groß!
Variante 1 mit Kaltauszug (Mazeration)
Beim Kaltauszug werden dem Neutralalkohol verschiedene gemahlene oder ausgepresste Botanicals beigefügt. Da die Zutaten gemahlen oder ausgepresst wurden, können sie ihre volle Geschmacksvielfalt entwickeln. Dies werden Sie bemerken, wenn Sie einen solchen Gin kaufen und probieren. Nach ein paar Wochen wird das Destillat gefiltert, etwas verdünnt und in Flaschen abgefüllt. Bei der Mehrfachmazeration gewinnt der Gin an Tiefe und erhält mehr Geschmacksnuancen. Allerdings darf dieser dann nicht mehr als „London Dry Gin“ vermarktet werden. Wenn Sie diesen Gin kaufen, steht dies für eine einmalige Mazeration. Durch das Einlegen der Gewürze in den Alkohol, werden den Botanicals die Farb- und Aromastoffe entzogen und an den Alkohol weitergegeben. Dabei gehen die Botanicals nicht unter, sondern schwimmen auf der Oberfläche des Alkohols. Der Unterschied zum Brand liegt darin, dass die einzelnen Zutaten des Gins nicht genügend Zucker enthalten und somit aus ihnen kein Alkohol gewonnen werden kann. Deshalb müssen die Zutaten in neutralen Alkohol eingelegt werden. Jedoch gibt es auch einige Hersteller, bei denen der Gin nicht während der Mazeration, sondern während der Destillation an Aroma gewinnt. In diesen Fällen füllen die Destillerien ihre Botanicals in einen Aromakorb, sodass die Dämpfe an den Botanicals im Korb vorbeiziehen und so dessen Aromen aufnehmen. Beim Gin kaufen haben Sie die Wahl – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack!
Variante 2 mit Heißauszug (Digestion)
Beim Gin kaufen gibt es eine weitere Herstellungsart – den Heißauszug. Dabei werden verschiedene Botanicals zerkleinert und in den 70 Grad warmen Alkohol eingelegt oder “gebadet“. Die Gewürze und Kräuter können somit auf eine schonende Art und Weise ihre Inhaltsstoffe an den Alkohol abgeben. Im Gegensatz zum Mazerationsverfahren werden bei dieser Methode die Farb- und Aromastoffe schneller aus den Zellwänden der Gewürze gezogen und besser an den Alkohol abgegeben. Dieses Verfahren ist jedoch komplizierter und bedarf viel Vorsicht, denn der Destillateur muss darauf achten, dass der Alkohol nicht zu schnell oder zu langsam erhitzt. Ansonsten besteht das Risiko, dass die Botanicals Bitterstoffe an den Alkohol abgeben – und die wenigsten Personen möchten einen Gin kaufen, der bitter schmeckt.
Variante 3 mit Mehrfacharomatisierung (Perkolation)
Sie können auch einen Gin kaufen, der mit der Methode der Mehrfacharomatisierung, unter anderem auch Dampfinfusion genannt, hergestellt wurde. Dabei werden Botanicals in große Siebe oberhalb des Brennapparates gelegt. Der gasförmige Alkohol wird mit Wasserdampf durch diese Siebe geleitet. Somit werden die vielfältigen Geschmacksaromen gelöst und behutsam an die Spirituose weitergegeben. Der große Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der Alkoholdampf nur Geschmacksstoffe aufnimmt und keine Bitterstoffe, die beim Gin kaufen weniger beliebt sind. Weil die Geschmacksstoffe nicht so stark ausgeprägt sind wie bei der Mazeration, werden bei diesem Verfahren in der Regel jene Botancials verwendet, die im Mazerationsverfahren zu stark gefiltert würden. Dafür müssen bei der Perkolation viel mehr Kräuter, Gewürze und Früchte eingesetzt werden, um genügend Aroma für einen guten Gin gewinnen zu können. Dieses Verfahren bringt deutlich höhere Produktionskosten mit sich, hat aber den Verkaufsvorteil, dass Gin, der auf diese Weise hergestellt wurde, als "Destilled Gin" verkauft werden kann. Destilled Gin kaufen kostet den Endverbraucher demnach mehr Geld, jedoch werden diese Sorten von vielen Gin Kennern besonders gerne getrunken.
Die Destillation
Nach einer weiteren Destillation entsteht die Gin-typisch klare Spirituose, die wir vom Gin kaufen gewohnt sind. Um Nebenerzeugnisse wie Fuselöle, Methanol und Essigtrester heraus zu selektieren, wird nach dem Brennvorgang Vor- und Nachlauf getrennt. Der Mittellauf bzw. das Endprodukt wird durch die Zugabe von Wasser auf eine Trinkstärke von gesetzlich festgelegten 37,5% Vol. reduziert. Personen, die Gin kaufen, der einen höheren Alkoholgehalt aufweist, assoziieren mit diesem häufig mit einem runderen Geschmack. Das Wasser und der Alkohol werden voneinander getrennt. Beim Erhitzen steigen die Dämpfe des Alkohols in der Brennblase auf, wo sie in eine gekühlte Spirale geleitet werden. Anschließend kondensiert der Dampf und wird flüssig. Das Ergebnis ist ein sehr hochprozentiger Gin (ca. 96%). Bevor Sie den Gin kaufen können, muss dieser mit Wasser verdünnt werden, da er sonst nicht trinkbar wäre. Das Erhitzen der Brennblase kann durch unterschiedliche Methoden erfolgen. Es gibt die klassische Methode mit Feuer, diese wird jedoch nur noch selten angewandt, da das Risiko zu groß ist, dass der Gin anbrennen könnte. Sie möchten allerdings bestimmt keinen angebrannten Gin kaufen. Stattdessen wird am häufigsten durch Gas oder elektrisch erhitzt. Dies hat vor allem den Vorteil, dass die gewünschte Temperatur schnell erreicht und gut kontrolliert werden kann.

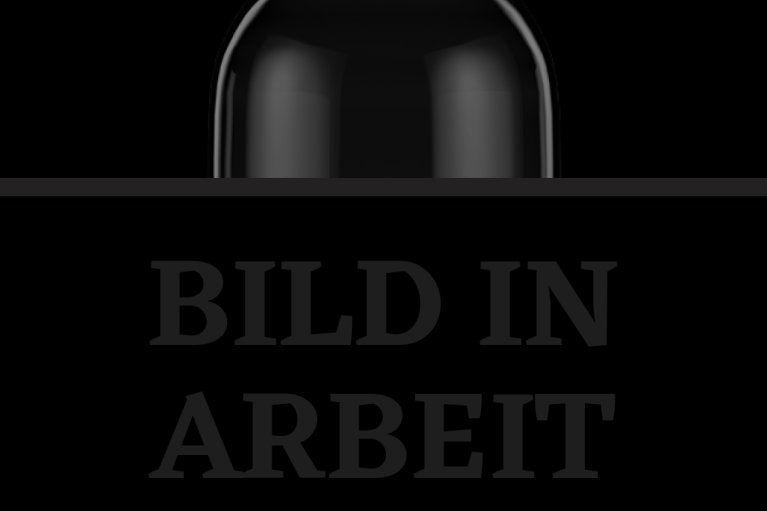










































































 Mit Amazon einloggen
Mit Amazon einloggen